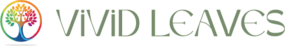Myelom Erkennen: Die Stillen Symptome, Die Sie Nicht Ignorieren Sollten
Myelom kann sich anfangs schleichend entwickeln, und viele der frühen Symptome werden oft übersehen. Müdigkeit, Knochenschmerzen oder häufige Infektionen können erste Warnsignale sein. Früherkennung ist entscheidend, um die Behandlungschancen zu verbessern und das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, um rechtzeitig zu handeln.

Das Multiple Myelom, auch Plasmozytom genannt, ist eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks, bei der sich Plasmazellen unkontrolliert vermehren. Diese Krebsform entwickelt sich meist langsam und bleibt oft lange unbemerkt. Die Symptome können anfangs sehr subtil sein und werden häufig als normale Alterserscheinungen abgetan. Eine frühzeitige Diagnose ist jedoch entscheidend für den Behandlungserfolg und kann die Prognose deutlich verbessern. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Anzeichen auf ein Myelom hindeuten können und wann Sie einen Arzt aufsuchen sollten.
Wie erkennt man frühe Symptome des Multiplen Myeloms?
Die frühen Anzeichen eines Multiplen Myeloms sind oft unspezifisch und werden daher leicht übersehen. Zu den ersten Warnsignalen gehören anhaltende Müdigkeit und Schwäche, die über das normale Maß hinausgehen. Viele Patienten berichten von einer zunehmenden Leistungsminderung im Alltag, die sie zunächst auf Stress oder das Alter zurückführen. Auch Knochenschmerzen, besonders im Bereich der Wirbelsäule, des Beckens oder der Rippen, können frühe Hinweise sein. Diese Schmerzen treten oft bei Bewegung auf oder verstärken sich nachts.
Ein weiteres wichtiges Frühsymptom ist die erhöhte Infektanfälligkeit. Betroffene leiden häufiger an Erkältungen, Bronchitis oder anderen Infektionen, die länger anhalten als gewöhnlich. Dies liegt an der Beeinträchtigung des Immunsystems durch die krankhaften Plasmazellen. Auch unerklärlicher Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit und wiederkehrende leichte Fieberschübe können auf ein Myelom hindeuten.
Weniger offensichtlich, aber ebenso bedeutsam sind neurologische Symptome wie Taubheitsgefühle, Kribbeln in den Extremitäten oder Konzentrationsstörungen. Diese entstehen durch die Ablagerung von Eiweißen, die von den Myelomzellen produziert werden und Nervenschäden verursachen können. Auch eine ungewöhnliche Blutungsneigung mit vermehrten blauen Flecken sollte aufmerksam beobachtet werden.
Welche Tipps gibt es zur Früherkennung und ärztlichen Untersuchung?
Bei anhaltenden unspezifischen Beschwerden wie chronischer Müdigkeit, Knochenschmerzen oder häufigen Infektionen ist es ratsam, einen Hausarzt aufzusuchen. Dieser kann zunächst eine gründliche Anamnese erheben und gezielte körperliche Untersuchungen durchführen. Besonders wichtig ist es, dem Arzt von der Dauer und Intensität der Symptome zu berichten und auch scheinbar unwichtige Beschwerden zu erwähnen.
Die Basisdiagnostik umfasst in der Regel Blutuntersuchungen, die wichtige Hinweise auf ein Myelom geben können. Dabei werden unter anderem das Blutbild, die Nierenwerte, der Kalziumspiegel und spezifische Proteine im Blut bestimmt. Eine erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) kann ein erster Hinweis sein. Auch der Nachweis von monoklonalen Proteinen (M-Proteine) im Blut oder Urin ist ein wichtiger diagnostischer Marker.
Bei Verdacht auf ein Myelom erfolgt die Überweisung zum Hämatologen oder Onkologen. Dieser veranlasst weitere spezifische Untersuchungen wie eine Knochenmarkpunktion, bildgebende Verfahren (Röntgen, CT, MRT oder PET-CT) zur Darstellung möglicher Knochenveränderungen und gegebenenfalls molekulargenetische Tests. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind besonders für Menschen über 60 Jahre und Personen mit familiärer Vorbelastung empfehlenswert, da das Risiko für ein Myelom mit dem Alter steigt.
Welche Lebensstilmaßnahmen unterstützen die Behandlung?
Eine gesunde Lebensweise kann die Behandlung des Multiplen Myeloms unterstützen und die Lebensqualität verbessern. Eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und ausreichend Protein stärkt das Immunsystem und hilft dem Körper, mit der Erkrankung und den Therapienebenwirkungen besser umzugehen. Da Myelom-Patienten oft unter Knochenproblemen leiden, ist eine ausreichende Zufuhr von Kalzium und Vitamin D besonders wichtig.
Regelmäßige, moderate körperliche Aktivität kann helfen, die Knochengesundheit zu erhalten, Müdigkeit zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Die Art und Intensität der Bewegung sollte jedoch immer mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden, da bei bestehenden Knochenläsionen ein erhöhtes Frakturrisiko besteht. Geeignet sind oft sanfte Sportarten wie Schwimmen, Walking oder spezielle physiotherapeutische Übungen.
Stressreduktion und psychische Unterstützung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Entspannungstechniken wie Progressive Muskelentspannung, Meditation oder Yoga können helfen, mit der psychischen Belastung umzugehen. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen oder die professionelle Unterstützung durch Psychoonkologen kann wertvoll sein. Ein geregelter Schlafrhythmus und ausreichend Erholung sind zudem essenziell, um die Energiereserven zu schonen und das Immunsystem zu stärken.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es im Überblick?
Die Therapie des Multiplen Myeloms hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt und bietet heute vielfältige Optionen. Die Behandlungsstrategie wird individuell angepasst und hängt von Faktoren wie dem Stadium der Erkrankung, dem Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten ab. Bei einem früh erkannten, asymptomatischen Myelom (Smoldering Multiple Myeloma) wird oft zunächst eine abwartende Haltung mit regelmäßigen Kontrollen eingenommen.
Bei behandlungsbedürftigen Myelomen kommen verschiedene Medikamentenklassen zum Einsatz. Proteasom-Inhibitoren wie Bortezomib, Carfilzomib oder Ixazomib hemmen den Abbau von Proteinen in den Myelomzellen und führen so zu deren Absterben. Immunmodulatorische Substanzen wie Lenalidomid, Pomalidomid oder Thalidomid beeinflussen das Immunsystem und hemmen das Wachstum der Krebszellen. Neuere Therapieansätze umfassen monoklonale Antikörper wie Daratumumab oder Elotuzumab, die gezielt an Strukturen auf der Oberfläche der Myelomzellen binden.
Bei jüngeren Patienten in gutem Allgemeinzustand wird oft eine Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender autologer Stammzelltransplantation durchgeführt. Hierbei werden eigene Blutstammzellen vor der intensiven Chemotherapie entnommen und später wieder zurückgegeben. Unterstützende Maßnahmen wie Bisphosphonate zur Stärkung der Knochen, Schmerztherapie und die Behandlung von Komplikationen wie Niereninsuffizienz oder Anämie ergänzen das Behandlungskonzept.
Innovative Therapieansätze wie CAR-T-Zell-Therapien, bei denen körpereigene Immunzellen genetisch modifiziert werden, um Myelomzellen gezielter bekämpfen zu können, befinden sich in klinischer Erprobung und zeigen vielversprechende Ergebnisse bei Patienten mit wiederkehrendem oder therapieresistentem Myelom.
Diagnose und Behandlung: Der Weg vom Verdacht zur Therapie
Der diagnostische Prozess bei Verdacht auf ein Multiples Myelom folgt einem strukturierten Ablauf. Nach der Erstvorstellung beim Hausarzt und den grundlegenden Blutuntersuchungen erfolgt bei auffälligen Befunden die Überweisung zum Spezialisten. Die definitive Diagnose erfordert in der Regel eine Knochenmarkpunktion, bei der Gewebeproben aus dem Beckenkamm oder Brustbein entnommen werden. Diese Proben werden unter dem Mikroskop untersucht und zeigen bei einem Myelom einen erhöhten Anteil abnormer Plasmazellen.
Nach der Diagnosestellung wird das Stadium der Erkrankung bestimmt, wobei heute meist das Revised International Staging System (R-ISS) verwendet wird. Dieses berücksichtigt Laborwerte wie Albumin und Beta-2-Mikroglobulin im Blut sowie genetische Veränderungen der Myelomzellen. Die Stadieneinteilung hilft bei der Prognoseabschätzung und der Therapieplanung.
Die Behandlung erfolgt in der Regel in spezialisierten hämatologisch-onkologischen Zentren oder Kliniken, oft im Rahmen von Studienprotokollen. Die Therapie gliedert sich typischerweise in eine Induktionsphase zur ersten Tumorreduktion, gegebenenfalls eine Konsolidierungsphase mit Hochdosistherapie und Stammzelltransplantation und eine Erhaltungstherapie zur Verzögerung eines Rückfalls. Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen dienen der frühzeitigen Erkennung von Rückfällen und der Überwachung von Therapienebenwirkungen.
Das Multiple Myelom ist zwar in den meisten Fällen nicht heilbar, aber dank moderner Therapien können heute längere Remissionsphasen und eine deutlich verbesserte Lebensqualität erreicht werden. Die frühzeitige Erkennung spielt dabei eine entscheidende Rolle, weshalb das Wissen um die oft subtilen Frühsymptome so wichtig ist.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und sollte nicht als medizinischer Rat verstanden werden. Bitte konsultieren Sie bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen immer einen qualifizierten Arzt für eine persönliche Beratung und Behandlung.